7 Todsünden
 Leidenschaften der Seele.
Leidenschaften der Seele.
Wie der Mensch durch die Erfüllung der Gebote Gottes sich im Sittlich-Guten üben und durch die häufige Wiederholung gute Gewohnheiten erwerben kann, die durch die Gnade Gottes sich festigen und zu Charakterzügen und Tugenden werden, so kann er auch, verführt durch die Dämonen, durch das Übertreten der Gebote sündigen und durch Wiederholungen sich immer mehr in die Sünde verstricken und in immer größere Abhängigkeit geraten, wodurch der Wille geschwächt und die Umkehr erschwert wird. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die durch den Sündenfall der Ureltern in Unordnung geratenen natürlichen Triebe des Menschen sich nicht mehr kontrollieren und vom Verstand nicht mehr entsprechend den Geboten Gottes steuern und beherrschen lassen. Durch diese Verhärtung in der sittlich schlechten Gewohnheit kommt die Seele in einen Zustand sittlich-geistlicher Erkrankung, den man als Leidenschaft (Pathos) oder Laster bezeichnet. Manchmal kann ein Mensch so sehr einem Automatismus der Sünde unterliegen, dass die Tat nicht mehr aus freiem Entschluss erfolgt. Trotzdem bleibt die sittliche Verantwortung und Schuld bestehen, wenn der Sünder willentlich in diesen Zustand des Lasters gekommen ist und nicht durch die Reue und Buße versucht, Sich davon zu befreien. Auch in schweren Fällen der Knechtschaft durch das Laster sind Befreiung und Heilung durch Gottes Gnade möglich. Zahlreiche Beispiele aus der Heiligen Schrift und aus den Heiligenviten können auch dem größten Sünder Mut und Hoffnung zur Umkehr geben. Nicht alle Sünden führen in gleicher Weise zur Bildung von schlechten Gewohnheiten, sondern vor allem jene, die in besonderer Weise der ungeordneten Selbstliebe und dem ungezügelten Trieb nach Genuss, Macht und Erwerb verbunden sind. Auf Grund dessen stellten die. Kirchenvater sogenannte Lasterkataloge zusammen, wobei spätestens seit Evagnus Ponticus (346-399) die Achtlasterlehre sich durchsetzte, die durch Johannes Kassian (ca. 360-435) auch im Westen Verbreitung fand, wo die Scholastik später die Reihe der sieben Todsünden entwickelte. Die klassische Achtlasterlehe zählt folgende Sünden auf: Völlerei, Unzucht, Geiz, Zorn, Traurigkeit, Trägheit, Hoffart, Stolz. Da diese Sünden nicht nur zu schwer abzulegenden Gewohnheiten führen, sondern meist auch noch eine Reihe anderer Sünden nach sich ziehen, werden sie auch Quell- oder Hauptsunden genannt. Diese Zusammenhänge sollen durch die nachfolgende Beschreibung der einzelnen Laster aufgedeckt werden.
 1. Die Völlerei
1. Die Völlerei
Dieses Laster entwickelt sich aus dem unbeherrschten Nahrungstrieb. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Übertreibungen: entweder die Vielfresserei oder die Feinschmeckerei, bei der es weniger um die Menge als um raffinierte Zubereitung und teure Delikatessen geht. Als verwandtes Laster kann man der Völlerei die Trunksucht beigesellen, die im Lasterkatalog nicht eigens erwähnt wird. Besonders schlimm ist, dass durch den
übermäßigen Alkoholkonsum der Mensch seines vernünftigen Denk- und Urteilsvermögens beraubt wird und in diesem Zustand die fürchterlichsten Dinge tun kann. Durch Völlerei und Trunksucht schadet der Mensch seiner
Gesundheit, einer Gabe Gottes, die er sorgfältig erhalten soll. Die Ausgaben für überflüssige oder teure Speisen und Getränke könnten sinnvoll für Almosen oder andere Zwecke ausgegeben werden. Durch Fasten, Gebet und durch die Tugend der Maßhaltung kann man dieses Laster bekämpfen.
 2. Die Unzucht
2. Die Unzucht
Ursache dieses Lasters ist der Geschlechtstrieb, dessen Beherrschung besonders in den Jugendjahren sehr schwer sein kann. Trotzdem ist die strenge Haltung des Evangeliums und der Orthodoxen Kirche, die die Erfüllung dieses Triebes nur in der Ehe erlaubt, keine Engherzigkeit und Prüderie, sondern die weise und menschenliebende Erkenntnis, dass echte Liebe von Dauer ist und deshalb eines von Gott gesegneten Rahmens bedarf, indem sie sich voll entfalten kann. Eine Triebbefriedigung außerhalb dieses gottgewollten Rahmens kann wohl das Lustbedürfnis momentan stillen, aber der Mensch kann kein dauerndes Glück finden und jagt deshalb von Abenteuer zu Abenteuer. Oft entstehen dann noch größere Sünden, wie zum Beispiel Ehebruch, Abtreibung unerwünschter Kinder, Eifersuchtsszenen usw. Dass das Laster der Unzucht sehr schlimme Folgen für die Gesundheit haben kann, war längst vor der Ausbreitung von AIDS bekannt. Auf psychischer Ebene kann das Laster zu schweren Neurosen führen. Bekämpft werden die Versuchungen der Unzucht durch Gebet, Fasten, durch die Tugenden der Keuschheit und der Maßhaltung, durch freiwillige Opfer und Meidung aller Gelegenheiten und Reizungen, die zur Sünde führen könnten.
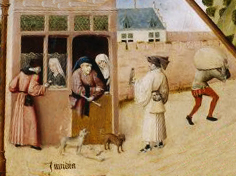 3. Der Geiz
3. Der Geiz
Der Geiz oder die Geldliebe ist das Ergebnis eines unbeherrschten Erwerbs und Besitztriebes. Nach dem Worte des Apostels Paulus ist sie “die Wurzel aller Übel; so manche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Weh bereitet” (1 Tim 6,10). Der Geizhals hat kein Vertrauen auf Gottes gütige Fürsorge, sondern glaubt an die Macht seines Geldes, das dadurch zu einem Götzen wird. In extremen Fällen kann der Geiz so groß sein, daß sich der Mensch sogar lebenswichtige Nahrung und andere Güter vorenthält. Der Geizige sündigt auch gegen die Nächstenliebe, denn mit seinem Überfluss könnte er die Not der Armen lindern. Nicht selten werden gerade fromme Menschen, die sonst ein gottgefälliges Leben führen, von diesem Dämon versucht und besiegt. Der Geiz wird am besten bekämpft durch das Almosengeben, die Nächstenliebe und durch eine großzügige Haltung in der Verwaltung des Geldes, die jedoch nicht in Verschwendung ausarten darf. Der Gedanke an Gottes liebevolle Vorsehung ist ebenfalls eine wirksame Waffe gegen dieses Laster.
 4. Der Zorn
4. Der Zorn
Der Zorn ist eine Gefühlserregung, die auf eine Beeinträchtigung unseres Selbsterhaltungstriebes oder infolge der Nichterfüllung eines Machtanspruches erfolgt. Wenn dieser Affekt nicht durch den Verstand und die verzeihende Liebe beherrscht wird, können die Folgen, ausgehend von der inneren Erregung über Beschimpfung, Handgreiflichkeit, die dramatischsten Formen bis Todschlag und Krieg annehmen. Der Zornige sündigt vor allem gegen das Gebot der Nächstenliebe. Während der Zorn als Aufflammen einer Gefühlserregung zwar sehr heftig und zerstörerisch sein kann, ist er meist von relativ kurzer Dauer. Er kann sich verlängern und die Form von Groll, Nachträglichkeit, Gehässigkeit und Hass annehmen und auf diese Weise die Beziehungen zwischen den Menschen vergiften. Den Zorn und seine Ableger bekämpfen wir durch die Tugenden der Sanftmut und der Geduld, der Nächstenliebe, der Feindesliebe, durch das Verzeihen gegenüber deren, die uns – vermeintlich oder wirklich – Unrecht getan haben. Ein sehr gutes Mittel ist das Gebet für die Personen, die uns Schwierigkeiten bereiten, und unsere Bereitschaft, ihnen zu verzeihen. Dadurch wird unsere Seele mit Frieden erfüllt, auch wenn die Betreffenden noch nicht bereit sind, sich mit uns zu versöhnen.
 5. Die Traurigkeit
5. Die Traurigkeit
Es handelt sich hier nicht um “die gottgewollte Betrübnis, die Umkehr zum Heil bewirkt, die nicht gereut”, sondern um die, von der der Apostel sagt “Die Betrübnis der Welt dagegen bewirkt den Tod” (2 Kor 7,10). Diese Art von Trauer ist entweder das Ergebnis von Kränkungen, Unrecht, äußeren Schwierigkeiten, die unsere Eigenliebe verletzen und die wir nicht durch Verzeihen, Großmut, Liebe überwinden, oder es handelt sich um Zustände der Melancholie, in die die Dämonen die Seele tauchen und sie an der Liebe Gottes, an Gott Selbst und an der eigenen Rettung zweifeln lassen. Diese Zustände des Gefühles totaler Verlassenheit können so stark sein, dass der Mensch verzweifelt und sogar seinem Leben freiwillig ein Ende setzt. Besonders sensible und melancholisch veranlagte Menschen neigen natürlich mehr zu dieser Sünde als unverbesserliche Optimisten, Diese Art der Trauer muss wirksam bekämpft werden durch die Aussprache mit dem Geistlichen Vater, durch das Gebet, die Lektüre der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, das Singen der Osterhymnen, den Gedanken an die Auferstehung und den Triumph Christi, den Umgang mit tiefgläubigen Menschen, die die Freude Gottes ausstrahlen.
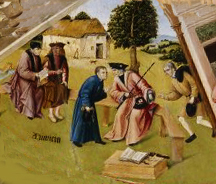 6. Die Trägheit
6. Die Trägheit
Die Trägheit kann den Menschen auf allen Ebenen erfassen, wenn er nicht wachsam im Gebet und im Bewusstsein der Gegenwart Gottes verharrt. Er ist dann wie gelähmt und hat einen Widerwillen gegen jede Anstrengung Besonders schlimm ist die geistliche Trägheit, die Trägheit, die den Menschen mit Überdruss am Gebet und am religiösen Leben allgemein erfüllt. Die geistliche Lustlosigkeit lähmt den Aufschwung aus der Dumpfheit. Ursache der Trägheit können der Einfluss der Dämonen, vor allem des “Mittagsdämons” (vgl. Ps 90,6), der Hang des Menschen zum Genießen und zur Bequemlichkeit, körperliche Ermüdung, Nachlässigkeit im Gebet und Sichverschließen vor Gott sein, Bekämpft wird die Trägheit durch Gebet, eine Aussprache mit dem Geistlichen Vater, Lektüre der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, physische und intellektuelle Arbeit. Mönche und Menschen, die allein leben, sind der Gefahr dieses Lasters besonders ausgesetzt. Die Grenzen zwischen der Trägheit und Trauer sind oft fließend.
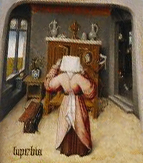 7. Die Hoffart
7. Die Hoffart
Die Hoffart oder Eitelkeit schmeichelt der Eigenliebe und der Ruhmsucht des Menschen, der nicht den Ruhm Gottes, sondern den eigenen Ruhm und das Lob der Menschen sucht. Der Hoffärtige sucht teure und auffällige
Kleidung und Luxus, um aufzufallen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dafür verschwendet er viel Geld, das man für wichtigere Aufgaben und für Wohltätigkeit verwenden könnte. Die ganze Tätigkeit des Hoffärtigen ist auf äußeren Effekt, Lob und Anerkennung ausgerichtet. Dadurch verlieren seine guten Werke ihren sittlichen Wert. Der ganze äußere Aufwand ist Ausdruck der inneren Überheblichkeit. Oft lässt Gott zu, dass die Überheblichen in Sünden fallen, die ihrem Rufe schaden, damit sie durch die Demütigung zur Reue und zu echter Demut kommen. Die Eitelkeit macht vor den Kirchentüren nicht halt. Viele sonst tugendhafte und fromme Christen nützen den Kirchgang zur Schaustellung ihrer Garderobe, ihres Schmuckes, machen Schenkungen, um sich mit goldenen Lettern auf der Wohltätertafel zu verewigen, engagieren sich im Gemeindeleben, um Lob und Anerkennung zu ernten. Bekanntlich ist auch der Klerus vor den Einflüssen des Dämons der Eitelkeit nicht immer gefeit. Diese kann sich zum Beispiel in prunkvollen Gewändern, pompösen Titeln, Heuchelei und Empfänglichkeit für Lobhudelei und Schmeichelei äußern. Die Hoffart läßt sich bekämpfen durch Einfachheit in der Kleidung und im ganzen Lebensstil, durch den Gedanken an das Gericht Gottes, dass all
unserer Sünden Ihm bekannt sind und allen offenbart werden. Der Gedanke an unsere Sünden hilft uns, das Lob, das man uns entgegenbringt, nicht ernst zu nehmen und Gott zu zuwenden. Auch der Gedanke an die Gebote
Gottes, an die Seligpreisungen und an unser klägliches Versagen, wenn wir unser Tun nach diesen Maßstäben messen, bewahrt uns vor dem eitlen Selbstruhm. Dasselbe gilt auch für die Lektüre der Bibel und der Heiligenleben, in denen wir uns spiegeln können und viele Runzeln und Häßlichkeiten an uns entdecken werden, die uns zu Bescheidenheit und Demut führen.
Der Stolz (Mutter aller Sünden)
Der Stolz oder Hochmut ist die Ursünde, durch die Engel und Menschen gefallen sind (vgl. Sir 10,12-13), er ist ein Streben nach Höhe, die Gott all ein gebührt, ein übersteigerter Egoismus, die Du-Losigkeit. Er ist unbeherrschte Eigenliebe, die sich auf verschiedene Weise äußert: als anmaßende Selbstüberhebung, Selbstgefälligkeit, Rechthaberei, dünkelhafte Eitelkeit, Ehrgeiz, Streben nach Macht, Besitz und Ehre, eitle Prahlerei, Sich-zur-Schau-Stellen, verwegene Kühnheit und Vermessenheit. Der Stolze verachtet Gott lind di e Mitmenschen und macht sich so zum eigenen Götzen. Er ist neidisch auf fremdes Glück und anerkennt die Leistungen anderer nicht. Um seiner Herrschsucht genüge zu leisten und seine Ziele zu erreichen, scheut der Stolze auch vor Verbrechen nicht zurück. Anstatt die Vergöttlichung durch die Gnade des Heiligen Geistes zu erstreben, sucht der Stolze die Selbstverherrlichung und Selbstentfaltung. Somit ist der Stolz als “Geist dieser Welt” (vgl. 1 Kor 2,12; 1 Joh 2,16) das genaue Gegenteil des Geistes der Demut und der Liebe, den Christus verkündet hat. Eine besondere Form der Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit ist der Pharisäismus, benannt nach dem bekannten Gleichnis aus dem Lukasevangelium (Lk 18,10- 14). Gerade Menschen mit einem sittlich hochstehenden Lebenswandel sind dieser Versuchung ausgesetzt, wenn sie ihre Tugenden nicht dankbar und bescheiden Gottes Gnade und Hilfe zuschreiben und sich nicht mit den eigenen Sünden und Fehlern beschäftigen. Eine andere Form des Stolzes besteht in der Selbstüberschätzung der eigenen Möglichkeiten unseres Ichs und seiner Grenzen. Im geistlichen Leben äußert sich dies darin, dass wir uns aus Eifer ohne den Segen des geistlichen Vaters – Askese und geistliche Kämpfe zumuten, die unsere Kräfte übersteigen und deshalb zu gefährlichem Scheitern verurteilt sind oder in den Irrtum führen, Auf der weltlichen Ebene lassen wir Verpflichtungen und Arbeiten auf uns zukommen, die zu Hektik und Stress und gar zum totalen Zusammenbruch führen, da wir unsere physischen Grenzen nicht sehen wollen und im richtigen Moment nicht nein sagen können oder weil wir uns für unersetzlich halten. Der Kampf gegen den Stolz ist ein harter Kampf, da er ein Kampf’ gegen unseren Egoismus ist. Gebet, Fasten, das bereitwillige Dienen und Verrichten demütigender Arbeiten für andere, der Gedanke an das Gericht, an die Größe und Güte Gottes und an unsere Kleinheit und Sündhaftigkeit helfen uns auf dem Weg zur echten Demut. Unsere Talente und guten Taten dürfen wir nicht uns selbst zuschreiben, sondern müssen sie dankbar als Gnaden und Geschenke Gottes anerkennen. Die häufige Beichte gibt uns die Möglichkeit, uns unserer Sünden anzuklagen und uns vor Gott zu demütigen und Ihn um Verzeihung zu bitten. Dadurch und durch den Empfang der heiligen Eucharistie schenkt Gott uns die Gnade zum erfolgreichen Kampf gegen dieses schlimmste aller Laster, aber auch gegen die anderen.
Comments are off for this post
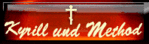 schreiben Sie uns
schreiben Sie uns



 hristianstvo
hristianstvo