Die Verehrung der Ikonen
 Einer der ersten Eindrücke eines Menschen, der ein orthodoxes Gotteshaus betritt, ist die große Zahl von Bildern des Herrn, der Gottesmutter und der Heiligen, die uns gleichsam von allen Seiten umgeben. Diese Bilder, die von Künstlern geschaffen wurden, heißen Ikonen. Im östlichen Teil der Kirche erhebt sich die Bilderwand oder Ikonostase, die gewöhnlich den Blick des Besuchers sofort fesselt. Rechts und links, auf den Säulen der Kirche und auf der Westwand, überall gibt es eine Vielzahl von Ikonen. Die Wände der Kirche sind oft mit Fresken versehen, auch das sind Ikonen.
Einer der ersten Eindrücke eines Menschen, der ein orthodoxes Gotteshaus betritt, ist die große Zahl von Bildern des Herrn, der Gottesmutter und der Heiligen, die uns gleichsam von allen Seiten umgeben. Diese Bilder, die von Künstlern geschaffen wurden, heißen Ikonen. Im östlichen Teil der Kirche erhebt sich die Bilderwand oder Ikonostase, die gewöhnlich den Blick des Besuchers sofort fesselt. Rechts und links, auf den Säulen der Kirche und auf der Westwand, überall gibt es eine Vielzahl von Ikonen. Die Wände der Kirche sind oft mit Fresken versehen, auch das sind Ikonen.
Jeder orthodoxe Christ hat unbedingt auch zu Hause Ikonen, vor denen er betet und die sein Heim heiligen. Manche haben alte, auf einem Holzbrett gemalte Ikonen, manche solche aus Papier, die auf einem Brett aufgeklebt sind. Aber das Wesentliche ändert sich durch diese Unterschiede nicht. Das Wort “Ikone” ist griechischen Ursprungs. Es bedeutet “Bild”, “Porträt”. In Byzanz, woher der orthodoxe Glaube in die Rus’ kam, war dies die Bezeichnung für jede Darstellung des Erlösers, der Gottesmutter oder der Heiligen, sogar für Skulpturen.
Warum sagen wir “heilige Ikone”, “heiliges Bild”? Die Ikonen werden in der Kirche geweiht, und durch diese Weihe kommt die Gnade des Heiligen Geistes auf sie herab. Es gibt eine große Zahl wundertätiger Ikonen: Durch sie geschehen durch Gottes Gnade viele Wunder, und die Menschen. die sie verehren, erhalten Trost und Hilfe. Wenn wir vor einer Ikone beten, müssen wir verstehen, dass die Ikone selbst nicht Gott ist, sondern nur das Bild Gottes oder eines Heiligen. Deshalb beten wir auch nicht zur Ikone, sondern zu demjenigen, der auf ihr dargestellt ist. Den Worten der Heiligen Väter und Kirchenlehrer gemäß geht “die Ehre, die wir dem Abbild darbringen auf das Urbild selbst über”, Dies bedeutet, dass unsere Verehrung Gott selbst gilt, wenn wir ein Bild Gottes verehren.
Wann sind die Ikonen entstanden?
In der Kirche des Alten Testaments war die Darstellung Gottes verboten.
Das von Gott erwählte Volk lebte unter Heiden, die Götzen und Bilde: furchtbarer Götter anbeteten. Ihnen dienten sie und brachten ihnen Opfer dar, darunter auch Menschenopfer. Der Herr aber gebot Seinem Volk durch den Propheten Mose, sich kein Abbild zu schaffen, d. h. kein Götzenbilc und es nicht wie Gott anzubeten. In jener Zeit hatte noch niemand Gott gesehen. Der Herr Jesus Christus war noch nicht in die Welt gekommen, und deshalb wäre jede Darstellung Gottes der bloßen Phantasie entsprungen und irrig gewesen.
Erst nach der Menschwerdung des Herrn, d. h. nachdem der Erlöser einen menschlichen Leib angenommen hatte, wurde eine solche Darstellung möglich.
Der kirchlichen Überlieferung nach war die erste Ikone das “nicht von Menschenhand geschaffene Bildnis des Erlösers”, das ohne Zutun menschlicher Hände entstanden war.
Dies geschah während des irdischen Lebens des Erlösers. Der Herrscher der Stadt Edessa, Fürst Abgar, war schwer erkrankt. Als Abgar von den zahlreichen Wundern und Heilungen hörte, die der Herr vollbrachte, schickte er einen Maler, damit dieser den Erlöser zeichne. Aber vom Gesicht des Herrn ging ein solches Leuchten aus, dass der Maler Ihn nicht malen konnte. Da trocknete der Herr Sein Gesicht mit einem Tuch ab, auf dem sich Sein göttliches Antlitz abbildete, und schickte dieses Tuch dem Fürsten. Als Abgar das Bild erhielt, wurde er von seiner Krankheit geheilt.
Die ersten Ikonen der Gottesmutter wurden noch während ihres Lebens vom Apostel und Evangelisten Lukas gemalt. Der kirchlichen Überlieferung nach sagte die Allheilige Gottesgebärerin, als sie ihre Darstellung sah: “Die Gnade des von mir Geborenen und mein Erbarmen sollen diese Bilder begleiten. “
So entstanden die ersten Ikonen. Aber die heilige Kirche wurde danach im Laufe von drei Jahrhunderten fast ununterbrochen verfolgt, zuerst durch die Juden, die nicht zum Glauben gefunden hatten, dann durch die Heiden. Sie verfolgten, folterten und töteten die Christen um des Namens des Herrn willen. Deshalb war es sehr gefährlich, heilige Bilder offen bei sich aufzubewahren. Die Gottesdienste wurden in unterirdischen Räumen, in Katakomben, gefeiert. Besonders weitläufige Katakomben befanden sich unter der Stadt Rom. Hier sind auf den Wänden die ältesten Ikonen des Erlösers und der Gottesmutter erhalten geblieben. Der Herr Jesus Christus wurde oft symbolisch in Form eines Fisches oder Lammes dargestellt.
Auf Griechisch heißt Fisch “ICHTHYS”. Die Buchstaben dieses Wortes sind die Anfangsbuchstaben der Wörter: “Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser”. Daher war der Fisch als Symbol für Christus besonders verbreitet. Kleine Fische aus Metall, Stein oder Perlmutt wurden oft am Hals getragen, wie wir jetzt das Taufkreuz tragen. Manchmal wurde auch das an den Herrn gerichtete Wort “Rette” darauf geschrieben, so wie man auch jetzt auf den Taufkreuzen die Worte “Rette und bewahre” schreibt.
Es sind auch Darstellungen der Apostel, der Märtyrer, der Heiligen und Engel erhalten geblieben. Die Verfolgung der Kirche hörte zu Beginn des IV. Jahrhunderts unter dem römischen Kaiser Konstantin auf, der selbst Christ wurde. Kirchen wurden gebaut. Ihre Innen Einrichtung wurde immer reicher und mannigfaltiger. Damals begann man, die Kirchen mit großen Fresken zu schmücken welche die Geschichte des Alten und Neuen Testaments darstellten. Diese Bilder waren für alle, sogar für Analphabeten, anschaulich und verständlich. Der heilige Neilos vom Sinai (V Jahrhundert), ein Schüler des Johannes Chrysostomos, schrieb über eine solche Ausstattung der Kirchen mit Ikonen: “Es soll die Hand des hervorragendsten Malers die Kirche mit Darstellungen des Alten und Neuen Testaments ausstatten, damit diejenigen, welche die Buchstaben nicht kennen und daher die heiligen Schriften nicht lesen können, bei der Betrachtung dieser Bilder der heldenhaften Taten derer gedenken, die Christus Gott wahrhaft gedient haben.”
Aber die Ikone ist nicht einfach eine Illustration der Erzählungen der Heiligen Schrift, sondern eine der Formen der Offenbarung und Erkenntnis Gottes. In sichtbaren Bildern und Symbolen spiegelt die Ikone die geistige Welt wieder und öffnet sie für die Betrachtung und das Verstehen. Mit anderen Worten, die Ikone erzählt uns von den gleichen Dingen wie das Evangelium und der Gottesdienst, aber sie spricht in der ihr eigenen Sprache.
In der Kirche herrscht Harmonie, alles ist eng miteinander verbunden. Deshalb ist es nicht möglich, die Darstellung eines Festes oder eines Heiligen, den Sinn und die Bedeutung der Details zu verstehen, wenn man das Ereignis der Heilsgeschichte, dem zu Ehren dieses Fest begangen wird oder das Leben des Heiligen, dessen Gedächtnis die Kirche an diesem Tag feiert, nicht kennt. Wie im Gottesdienst, ist auch jedes Detail einer Ikone mit Sinn erfüllt und hat seine besondere Bedeutung. Da aber die Ikone die geistige Realität darstellt, d. h. das, wofür es in der sichtbaren Welt kein Ebenbild gibt, werden die geistigen Begriffe durch Symbole wiedergegeben. Zum Beispiel bedeutet der Heiligenschein auf dem Haupt die Heiligkeit bzw. den Glanz der Herrlichkeit Gottes. Auf der Ikone des Erlösers wird im Heiligenschein immer ein Kreuz gemalt, im Kreuz die Buchstaben “O WH”. Es ist dies ein griechisches Wort, das mit “Seiender” (Der ICI Bin) übersetzt wird und darauf hinweist, dass auf der Ikone Gott der Heer dargestellt ist. Daneben -zumeist an beiden Seiten -steht der abgekürzte Name “HC XC” -Jesus Christus.
((Книга о церкви: Лоргус,Дудко))
Comments are off for this post
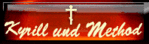 schreiben Sie uns
schreiben Sie uns



 hristianstvo
hristianstvo